Alumnus im Porträt: Walter Klemm
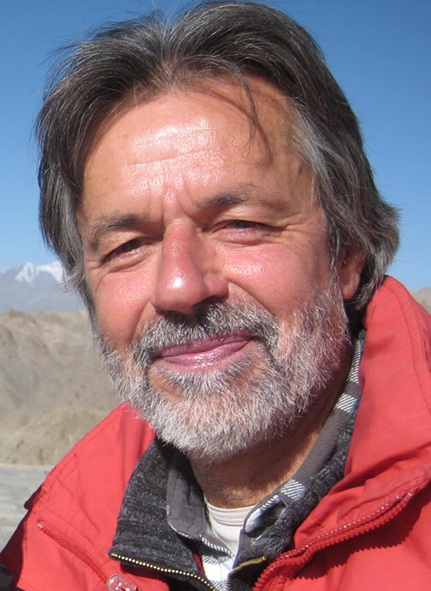 Walter Klemm promovierte am Institut für Wasserbau und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe. Sein beruflicher Weg beinhaltete verschiedene Stationen und führte ihn in über 40 Länder weltweit. Nach der Gründung und elfjährigen Leitung eines Ingenieurbüros für Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz war er u.a. für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen tätig und betreute Projekte im Nordirak und Afghanistan. Nach seiner Pensionierung folgten Missionen u.a. für die Weltbank und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Berater.
Walter Klemm promovierte am Institut für Wasserbau und Kulturtechnik der Universität Karlsruhe. Sein beruflicher Weg beinhaltete verschiedene Stationen und führte ihn in über 40 Länder weltweit. Nach der Gründung und elfjährigen Leitung eines Ingenieurbüros für Wasserwirtschaft und Ressourcenschutz war er u.a. für die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen tätig und betreute Projekte im Nordirak und Afghanistan. Nach seiner Pensionierung folgten Missionen u.a. für die Weltbank und die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) als Berater.
Welche wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse aus Ihrer Zeit am KIT prägen Sie noch heute?
Ich war von 1983 bis 1989 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wasserbau und Kulturtechnik angestellt. Soweit ich mich erinnere, war ich der erste Doktorand, der nicht am Lehrstuhl studiert hatte. Dies hatte ich sicher der aufgeschlossenen und toleranten Art meines Professors Peter Larsen (selbst "Quereinsteiger") zu verdanken, der mir sehr viel Freiheit in der Planung von Vorlesungen für Kulturtechnik (= Bewässerung, Entwässerung und Erosionsschutz) gelassen hat und meine Forschungsprojekte tatkräftig unterstützte.
Zu der Zeit wurde das Bild des Wasserbauingenieurs (ein Flussbegradiger, reiner Techniker, etc.) in Frage gestellt, und von (relativ) jungen Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern dahingehend verändert, dass in der Ingenieurausbildung an der Technischen Universität Karlsruhe gesellschaftspolitische Themen (z.B. Kernkraftnutzung) und die ökologische Ausrichtung in Fachgebieten wie Wasserbau und Wasserwirtschaft eine immer größere Rolle spielten. Diese Entwicklung unterstreicht, dass die Bewahrung von Lehr- und Forschungsexzellenz nur durch mutige und entschlossene Veränderung der bestehenden Verhältnisse möglich ist. Auch wenn mir der direkte Vergleich zu anderen deutschen Universitäten in jener Zeit fehlt, bin ich mir sicher, dass die Technische Universität Karlsruhe in vorderster Front positive Veränderungen im Lehr- und Forschungsangebot sowie bei der (wissenschaftlichen) Mitarbeiterverantwortung bewirkt hat.
Welchen Mehrwert ziehen Sie daraus, Mitglied im Alumninetzwerk zu sein?
Der Mehrwert ergibt sich vorwiegend durch die Informationsvermittlung. Was passiert am KIT? Gibt es interessante Forschungsvorhaben? Etc. Durch meine entfernungsbedingte Abwesenheit von Karlsruhe habe ich bisher leider an keinen vom Alumninetzwerk organisierten Veranstaltungen teilgenommen; was ich bedaure, da es eine große Palette von interessanten Themen gab und auch noch gibt.
Welche Vision haben Sie für das KIT?
Meine Anregungen zu möglichen, wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen des KIT sind:
- Lehre (allgemein): Nach einer kurzen (1-2 Semester) Vermittlung von Grundlagen in Hörsälen, nur noch projektbezogene Arbeit in Gruppen an Tischen in Seminarräumen. Dies fördert selbstverantwortliches und ergebnisbetontes Handeln sowie kreatives Denken und Teamwork.
- Lehre (spezifisch): Ich kann hier nur Lehrgebiete einschließen, mit denen ich mich selbst in der Vergangenheit beschäftigt habe.
Klima: Natürlich ist es wichtig, möglichst realistische Klimamodelle zu entwickeln und Vorhersagen zu treffen. Allerdings ist es m.E. noch wichtiger, für die antizipierten Klimaveränderungen Gegenmaßnahmen zu entwickeln, die uns die Möglichkeit geben, mit den voraussichtlich eintreffenden Prognosen zu (über)leben.
Ressourcenschutz: Der Schutz von Luft, Wasser, Böden, Flora und Fauna (Biodiversität) sollte Gegenstand jeglicher Wissensvermittlung in allen Fächern sein, d.h. integraler Bestandteil gesellschaftspolitischen Handelns in der Anwendung technischer Lösungen im Alltag.
Erosionsschutz, vor allem im alpinen Gebiet: Der Schutz von Siedlungsgebieten im alpinen Raum sollte viel mehr in den Vordergrund gerückt werden, um die alpine Kultur und Traditionen zu bewahren, die durch die Verschiebung der Permafrostgrenze bedroht sind.
Forschung: Es gibt sicher spezielle und vielversprechende Forschungsaktivitäten in den oben genannten Lehrfeldern Klima, Ressourcenschutz und (alpiner) Erosionsschutz. Das wichtigste Forschungsthema, das allen genannten Feldern zugute kommt, ist m.E. jedoch Wasserstoff. Die Anstrengungen in der Wasserstoffforschung erinnern mich an die Forschungsmittelverwendung für Solar- und Kernenergie in den Siebziger und Achtziger Jahren: Über 90% der Mittel flossen in die Erforschung der Kernenergie, weniger als 10% in die Erforschung der Solarenergie. Eine damals völlig verkannte Entwicklung zukünftiger Energienutzung!
Ich möchte anregen, parallel zur vielfältigen und – zurecht - technologischen Ausrichtung des KIT, der Wasserstoffforschung Vorrang zu gegeben und die Bedeutung gesellschaftspolitischen Engagements für eine ökologische und nachhaltige Lebensweise in technisch orientierte Fachgebiete zu integrieren.
